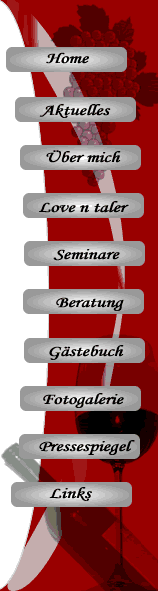Als ich zusammen mit meinem Vater Adolf Pulsinger 1994 unseren kleinen Weinbaubetrieb gründete, war es anfänglich mein Ziel gewesen, die Erkenntnisse aus meiner Diplomarbeit in die Praxis umzusetzen. Ich wollte zeigen, dass Kärnten und insbesondere das Lavanttal ansprechende Qualitätsweine hervorbringen kann. Es ging mir also darum, das volle Potential auszuschöpfen und mich schrittweise an die Grenzen des M öglichen heranzutasten. Unsere Lage am Paizikogel kann man klimatisch zu den mittleren bis guten Weinbaulagen K ärntens zählen. Es gibt in Kärnten einige Lagen mit noch besseren klimatischen Bedingungen, womit die Ergebnisse unserer Versuchsanlage ohne Probleme übertragen werden können.
Mit der Beteiligung am Projekt Stadtweingarten Klagenfurt wollte ich vor allem das Potential der Rebsorte Rheinriesling ausschöpfen. Diese Rebsorte gilt als die ´Königin´ unter den Weißweinsorten und ist durch ihre späte Reife für einen Weinanbau in Kärnten eine echte Herausforderung.
Weine mit Rückgrat und Lagerpotential
Von Anfang an wollte ich mich nicht auf das landläufige Klischee für Kärntner Weine (weiß, säurebetont, wenig Körper, primärfruchtig, geringe Lagerfähigkeit) beschränken, sondern das Potential unserer Lage(n) und Rebsorten zur Gänze ausreizen. Wir versuchen, soweit es der Jahrgang erlaubt, Weine mit zumindest mittlerem Körper und Lagerpotential zu keltern. Vorraussetzung dafür ist eine Ertragsbeschränkung im Weingarten und das Ausnützen der Vegetationszeit im Herbst (späte Lese).
Die Rotweine werden nach dem biologischen Säureabbau 8 bis 12 Monate in kleinen Eichenholzfässern zwischen 52 Litern (Viertelbarrique) und 115 Litern (Halbbarrique) ausgebaut.
In manchen Jahren produzieren wir (so wie im Jahr 2005) auch edelsüße Prädikatsweine, welche jenen anderer Weinbaugebiete in Österreich um nichts nachstehen.
Weinmanufaktur
Mit diesem Begriff will ich bewusst einen Gegenakzent zum Begriff Weinindustrie setzen. In der modernen und globalisierten Weinwelt werden zunehmend Verfahren eingesetzt, die dem Spruch “in vino veritas – im Wein liegt die Wahrheit“ widersprechen. So wird z.B. in der Neuen Welt (Kalifornien, Australien, …) der Wein im so genannten Schleuderkegelkolonnenverfahren in seine einzelnen Komponenten zerlegt und je nach gewünschten Geschmacksrichtungen wieder “zusammengebaut“. Auch die Zugabe von Eichenholzspänen anstelle des Weinausbaus in Holzfässern und die Eindickung des Traubenmostes (Mostkonzentration durch Umkehrosmose oder Vakuumverdampfung) vor der Vergärung sind mittlerweile gängige Praxis in vielen modernen Weinbaubetrieben auf der Welt.
Im Gegensatz dazu steht der Begriff Weinmanufaktur für den intuitiven und schonenden Umgang mit dem Organismus Wein. Wir verstehen den Wein als Lebewesen mit all seinen Höhen und Tiefen, welchen man mit viel Geduld auf dem Weg seiner Reifung begleiten soll. Das Wort Manufaktur leitet sich vom Lateinischen “cum mano facere “ bzw. “cum mano faktum est“ was soviel wie mit der Hand machen bzw. mit der Hand gemacht bedeutet. Wir versuchen unsere Weine mit so wenigen Eingriffen wie möglich und so vielen wie nötig zu machen. Wir verzichten auf den Einsatz von Maischeenzymen und sämtliche Schönungen, bis auf Säurekorrekturen bei manchen Weißweinen und Eiklarschönung beim Rotwein. Alle Rotweine werden auf der Maische vergoren (10-20 Tage) und machen den biologischen Säureabbau. Wir arbeiten bis zur Flaschenfüllung der Weine ohne Filtration und ohne Pumpen. Die Weine dürfen sich von selbst klären und so lange reifen, bis sie sich selbst reif genug für die Abfüllung finden. Zur Klärung werden die Weine unter Ausnützung der Schwerkraft abgezogen. Trotz unserer zurückhaltenden Ausbauweise verschließen wir uns nicht den neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen, soweit sie mit unserer Philosophie übereinstimmen. So wird in machen Jahren beim Rotwein auch die Methode der Kaltmazeration (die Maische wird vor der Gärung 1 Woche im Kühlraum bei 2° C gelagert, womit der Wein mehr Frucht und Farbe bekommt) oder der Vorsaftentzug (20 % des Seihmostes werden zwecks natürlicher Konzentration der Maische als Seihmost abgezogen und als Roséwein vergoren) angewandt.
|